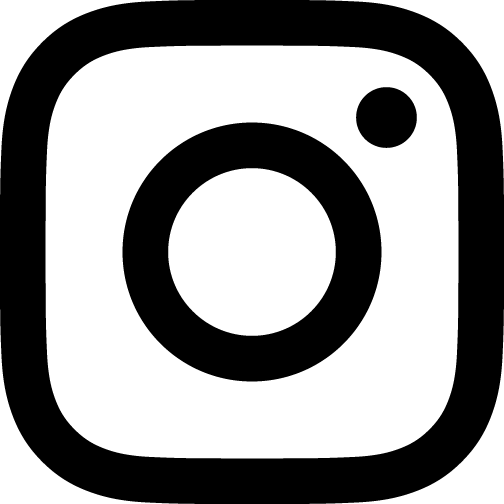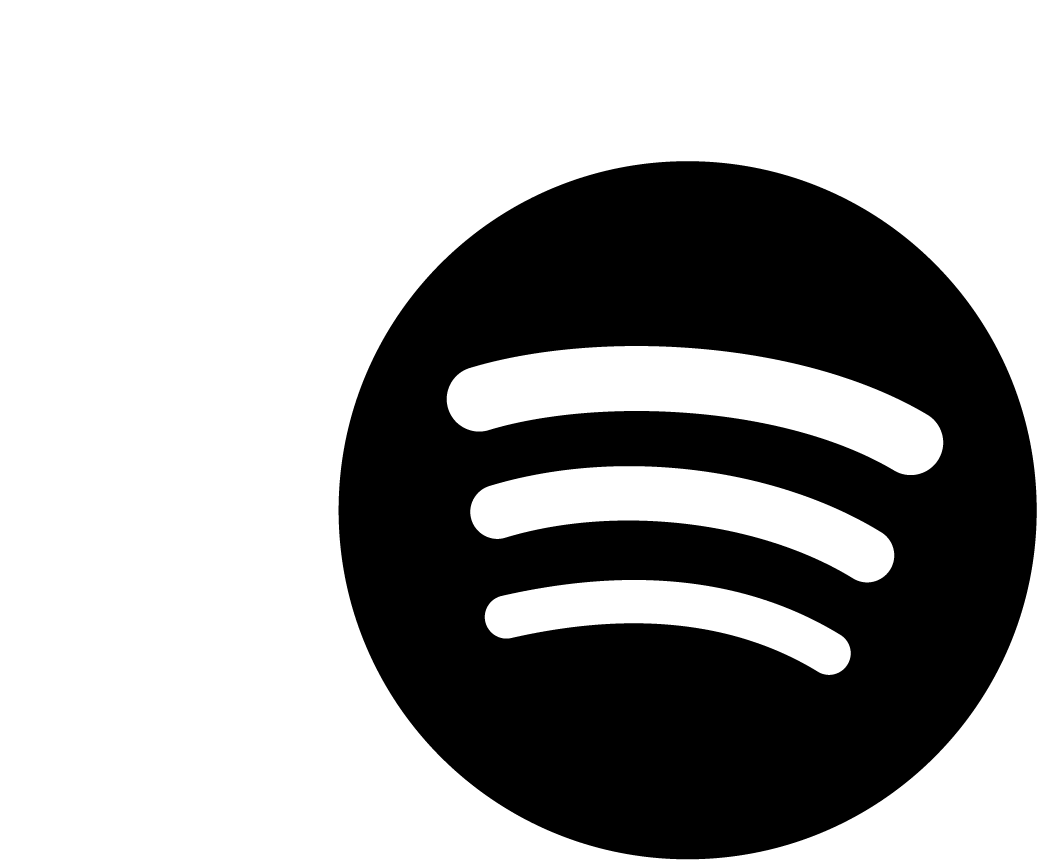Berufsorientierung
Philosophieren schafft OrientierungI
Das Ende der Schulzeit stellt junge Menschen vor eine große Herausforderung: Sie müssen sich für oder gegen eine Berufsausbildung oder ein Studium entscheiden. Doch viele Schüler*innen fühlen sich nicht genug darauf vorbereitet, zu wissen wie sie ihr berufliches Leben gestalten wollen.
Die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen, Vorstellungen, Werten und Zielen verschafft ihnen mehr Klarheit und ein höheres Zutrauen in sich selbst und damit eine größere Sicherheit für eine eigenverantwortliche Entscheidung.
Was ist mir im Leben wirklich wichtig? Was hat mein zukünftiger Beruf damit zu tun? Wie treffe ich eine gute Entscheidung? Welche Werte und Bedürfnisse stehen hinter meinen Zielen und Entscheidungen?